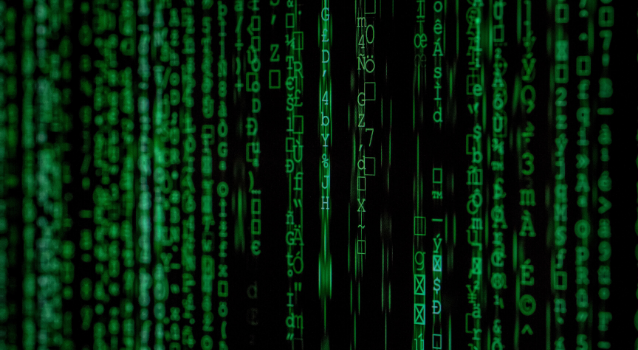Konferenzen im Netz: Gut für das Klima
Die jährliche Konferenz der International Society for Professional Innovation Management (ISPIM) bringt führende Innovationsforscher und -praktiker aus aller Welt zusammen. Sie findet wie viele Tagungen in Zeiten von Reisewarnungen und Kontaktverboten dieses Jahr virtuell statt. Eigentlich war Berlin als Veranstaltungsort vorgesehen. Aufgrund der aktuellen Lage heißt das neue Konferenzmotto jedoch „Innovating in times of crisis“. Getagt wird im Netz.
Virtuelle ISPIM spart 95% der CO2-Emissionen
Das Borderstep Institut, Partner und Mitveranstalter des Events, hat die Auswirkungen dieser Entscheidung auf das Klima berechnet. Die wegfallende Anreise der Teilnehmenden führt etwa zu einer Reduktion des CO2-Fußabdrucks um den Faktor 20. An der ISPIM-Konferenz hätten etwa 600 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern teilgenommen, davon über 130 mit weltweiten Anreisen von anderen Kontinenten. Diese Veranstaltung vor Ort würde allein durch die Interkontinentalflüge zu CO2-Emissionen in der Höhe von etwa 850 Tonnen führen, einschließlich des Aufenthalts der Reisenden vor Ort. Die Anreise der europäischen Teilnehmenden zu einer Veranstaltung und der Aufenthalt in Berlin würde weitere 100 Tonnen CO2 verursachen.
Netztagungen ersetzen nicht persönlichen Austausch
Mit der virtuellen Konferenz werden nun etwa 95% der CO2-Emissionen der ursprünglich geplanten Veranstaltung vor Ort eingespart. Unter Klimaschutzgesichtspunkten haben virtuelle Konferenzen also eindeutig Vorteile. Gleichzeitig ist klar, dass Netztagungen nicht den persönlichen Austausch in der Kaffeepause oder das informelle Networking bei den Social Events und der Konferenzparty ersetzen können. Die Lösung könnte darin liegen, physische Tagungen im Wechsel mit virtuellen Konferenzen durchzuführen oder Mischformen zu nutzen, bei denen Keynote Speaker nicht mehr eingeflogen, sondern per Video dazu geschaltet werden.
Wie verändert Corona langfristig das Reiseverhalten im Job?
Borderstep beschäftigt sich bereits seit Herbst 2019 in einem Forschungsprojekt mit der Frage, wie die Digitalisierung zum Klimaschutz beitragen kann. Das Forschungsteam hat dafür Befragungen rund um virtuelle Konferenzen und das Geschäftsreiseverhalten durchgeführt. Es zeigt sich, dass bisher für viele die Kommunikation per Video nur eine untergeordnete Rolle spielte. Seit März 2020 aber nutzen viele Unternehmen den virtuellen Raum nicht nur für die interne Kommunikation, sondern auch für Veranstaltungen. Die Borderstep-Studie zeigt, warum sich erst jetzt, wo nicht mehr gereist werden kann, die Videokonferenz erstmals wirklich durchsetzt. Die Interviews weisen darauf hin, dass das Reiseverhalten nie mehr so wird wie vor Corona.
Hintergrund
Die internationale Konferenz der „International Society for Professional Innovation Management“ (ISPIM), die vom 7. bis 10. Juni 2020 in Berlin stattfinden sollte, wurde wie viele andere Events aufgrund der Corona Krise auf das Jahr 2021 verschoben. Um den wissenschaftlichen Austausch aber dennoch aufrecht zu erhalten, findet die Tagung nun in diesem Jahr als virtuelle Konferenz statt.
Virtuelle ISPIM: 50 Tonnen C02 statt 1.000
Das alles hat negative Auswirkungen auf die Hotel- und Reisebranche, auf die Fluggesellschaften und die Cateringunternehmen und auch auf Berlin als Konferenzstandort. Aber es entlastet auch die Umwelt. Der materielle Aufwand für eine virtuelle Konferenz ist ungleich geringer. Nach Berechnungen des Borderstep Instituts, hätten die etwa 600 vorwiegend internationalen Gäste der ISPIM durch die Inanspruchnahme von Reise- und Hoteldienstleistungen zusammengenommen etwa 950 Tonnen CO2-Emissionen verursacht. Der CO2-Ausstoß der virtuellen Variante wurde auf Basis von aktuellen Daten über die zusätzliche Auslastung des Internets durch Videoconferencing sowie auf Basis von Borderstep-Daten zum Energieverbrauch von Rechenzentren und dem Internet abgeschätzt. In der virtuellen Variante werden die CO2-Emissionen nur bei etwa 50 Tonnen liegen.
Wie nützt die Digitalisierung dem Klimaschutz?
Aber warum findet so ein virtuelles Event erst jetzt statt? Warum waren virtuelle Konferenzen „vor Corona“ technisch gut ausgerüsteten Staatspräsidenten, Ministern und Konzernchefs sowie einer kleinen Gruppe von IT-Pilotanwendern vorbehalten?
Mit dieser Frage beschäftigt sich aktuell das Borderstep Projekt „Klimaschutzpotenziale der digitalen Transformation“. Seit Herbst 2019 fragte das Forschungsteam in qualitativen Interviews nach Hintergründen von und Erfahrungen mit virtuellen Meetings.
Videokonferenzen waren „vor Corona“ wenig verbreitet
Bisher nutzte die Breite der befragten Geschäftsleute, über 90%, eigentlich nur Telefonkonferenzen. Nachteil dieser Kommunikationsform: Es kann keine Präsentation gezeigt werden, man sieht sich nicht, Mimik und Gestik werden nicht wahrgenommen. So bleibt alles oft auf der sachlichen Ebene.
Dr. Jens Clausen, Projektleiter Forschungsvorhaben CliDiTrans und Co-Autor der Studie: „In der Kürze der Besprechung werden persönliche Konflikte manchmal eher verschärft als aufgelöst. Bei Videokonferenzen können Präsentationen gezeigt werden, auch Mimik und Gestik sind sichtbar. Damit ist eine Videokonferenz in ganz anderer Weise als ein Gruppentelefonat ein Event, bei dem Informationen ähnlich wie im Konferenzraum grafisch unterstützt werden können. Kolleginnen und Kollegen werden bewusst und als Person wahrgenommen.“
Stefanie Schramm, Researcherin am Borderstep Institut und Co-Autorin der Studie: „Der Mehrwert von Videokonferenzen zeigte sich aber erst, als die Ressentiments gegen die unbekannte und ungeübte Kommunikationsform überwunden werden mussten. Seit dem Lockdown beobachten wir einen bisher unbekannten Run auf Videokonferenzen – viele lernen erst durch diese erzwungene Testphase Vor- und Nachteile dieser technischen Anwendung kennen.“
Gute Argumente für weniger Geschäftsreisen
Das Fazit des Forschungsteams nach der Auswertung der Interviews ist deutlich: Videokonferenzen werden sich auch nach dem Lockdown etablieren. Gerade bei kurzen Meetings sparen sie oft nicht nur Reisekosten, sondern ein Mehrfaches der Konferenzdauer an Reisezeit. Virtuelle Meetings sind damit nicht nur klimafreundlich, sondern auch zeitsparend.
Warum brauchte es die Krise für diese Erkenntnis? Die Interviews zeigen, dass vor dem Lockdown virtuelle Meetings mit großer Unsicherheit betrachtet wurden und ihnen in der Geschäftswelt wenig Wertschätzung entgegengebracht wurde.
Dr. Jens Clausen, Projektleiter Forschungsvorhaben CliDiTrans und Co-Autor der Studie: „Hier kommen zwei Punkte zusammen. Einerseits wären noch vor wenigen Jahren die Internetverbindungen nicht gut genug gewesen. Deshalb kann sich das „Window of Opportunity“ der Videokonferenz erst jetzt öffnen. Zweitens ist es für Menschen grundsätzlich schwierig, Routinen zu ändern.“
Nur einige IT-Nerds schwärmten auch vor Corona schon von den Vorteilen der Videokonferenz. Corona-bedingt sind Unternehmen und ihre Angestellten nun zu einer längeren „Testphase“ gezwungen, die bei vielen Vorbehalte und Bedenken abgebaut hat. Das Forschungsteam geht deshalb davon aus, dass virtuelle Treffen auch in Zukunft in der Geschäftswelt eine wichtige Rolle spielen und Reisen im Job sich deutlich reduzieren werden. Doch das ist nach den Erkenntnissen des Projekts kein Selbstläufer.
Borderstep im Podcast
Im Podcast Knowco & Collabwith spricht Borderstep Gründer Prof. Dr. Klaus Fichter darüber, wie man die Auswirkungen von Neugründungen messen und im Rahmen der SDG Ziele bewerten kann. Welche Rolle spielt dabei die Wissenschaft?
Die Produktion ist eine Kollaboration mit der Innovationskonferenz ISPIM. Sie findet vom 7. bis 10. Juni 2020 online statt. Ihr Motto lautet: „Innovation in Zeiten der Krise“.
In diesem Rahmen präsentiert Borderstep das diesjährige Borderstep Impact Forum. Dabei handelt es sich um verschiedene Workshops, die sich mit der Wirkungsmessung von Start-ups beschäftigen.
Den Podcast mit Klaus Fichter kann man hier anhören.
Klimaschutz durch digitale Technologien
Die Digitalisierung kann eine zentrale Rolle beim Klimaschutz einnehmen. Allerdings ist digitaler Klimaschutz kein Selbstläufer, sondern muss von den Unternehmen aktiv betrieben und von der Politik gezielt flankiert werden.
Im Rahmen einer Metastudie im Auftrag des Digitalverbands Bitkom untersucht das Borderstep Institut gemeinsam mit der Universität Zürich die direkten und indirekten Auswirkungen der Digitalisierung auf den Klimaschutz.
Ziel ist es, konkrete Handlungsfelder zu identifizieren: In welchen Bereichen besitzt die Digitalisierung besonders große Potentiale für den Klimaschutz und wie können sie genutzt werden? Und welche klimaschädlichen Wirkungen können von digitalen Technologien ausgehen und wie lassen sie sich reduzieren?
Die Kurzstudie kann kostenfrei heruntergeladen werden.
Ist Netflixen schlecht für die Umwelt?
Ist Netflixen schlecht für die Umwelt? Das fragt ein Artikel auf dem Portal Businessinsider. Es berichtet über die Auswirkungen von Extrem-Streaming und Homeoffice in Zeiten von Corona auf Umwelt, Energieverbrauch und CO2-Bilanz.
Zu Wort kommt Dr. Ralph Hintemann, Senior Researcher und Experte für Digitalthemen bei Borderstep. Er analysiert, wie sich Videostreamen auf das Klima auswirken. Zitiert werden dabei auch Ergebnisse verschiedener Borderstep-Studien zum Thema.
Der Artikel kann hier nachgelesen werden.
Rendite für alle
Rendite für alle: So titelt die Tageszeitung taz und berichtet über die Ergebnisse des aktuellen Green Startup Monitors. Damit nimmt die Zeitung Bezug auf die „doppelte Dividende“, die nachhaltig orientierte Start-ups sowohl für ihre Kapitalgeber als auch die Gesellschaft ausschütten, wie es Borderstep-Direktor Prof. Dr. Klaus Fichter in der Pressekonferenz formulierte.
Quote der Gründerinnen hoch
Auch auf dem Weg zur Geschlechtergerechtigkeit gehen grüne Start-ups voran, wie Studienautorin Dr. Yasmin Olteanu berichtete. Die Quote der Gründerinnen von grünen Start-ups ist deutlich höher als bei herkömmlichen Start-ups.
Der Green Startup Monitor analysiert die Bedeutung jener Startups, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen einen Beitrag zu den ökologischen Zielen einer Green Economy leisten. Er wurde vom Borderstep Institut und dem Bundesverband Deutsche Startups im Jahr 2020 zum zweiten Mal erstellt und wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert.
Green Startup Monitor kostenlos herunterladen
Der Green Startup Monitor 2020 kann kostenlos heruntergeladen werden.
Der Artikel kann hier nachgelesen werden.
Künstliche Intelligenz für Start-up Tool
In Zusammenarbeit mit einem vierköpfigen Team des deutsch-tunesischen Tech-Start-ups Think.iT erforscht Borderstep Senior Researcher Dr. Jannic Horne zusammen mit Borderstep Researcherin Constanze Trautwein und Borderstep Senior Projektmanager Alexander Schabel das Potenzial von KI für verbesserte Bewertungsverfahren von Start-ups.
Um diese Verfahren effizienter, standardisierter und richtungssicherer zu gestalten, wird in einem Pilotprojekt mit Hilfe von Natural Language Processing das Potential der automatisierten Datenerhebung und –analyse zu innovativen Start-ups ergründet. Auch verschiedene Verfahren wie z.B. die Vektorrepräsentation von Start-ups, Netzwerkanalysen von Gründern oder Sentimentanalysen werden untersucht.
Die ersten vorliegenden Ergebnisse stimmen das Forschungsteam zuversichtlich, dass KI-gestützte Bewertungsverfahren dazu beitragen können, mehr Transparenz in der Bewertung von Nachhaltigkeitspotenzialen und – risiken von Start-ups zu schaffen.
Green Startup Monitor 2020
Der Green Startup Monitor 2020 feiert am 29. April Premiere und Sie können live mit dabei sein.Wir übertragen die Pressekonferenz per Stream.
Die weltweite Wirtschaft ist verwundbar. Das zeigt die aktuelle Krise. Die Widerstandsfähigkeit der Ökonomie muss deshalb Schwerpunkt des wirtschaftlichen Wiederaufbaus sein. Doch wie kann der Aufbau einer nachhaltigen Wirtschaft gelingen?
Was sind die größten Herausforderungen für grüne Startups?
Grüne Startups können in diesem Zusammenhang eine Vorbildrolle einnehmen. Sie sind ein mittlerweile bedeutender Teil des deutschen Startup-Ökosystems. Jedes fünfte deutsche Startup ordnet sich der Green Economy zu. Wie steht es um diese Startups in Deutschland? Was sind die größten Herausforderungen? Und wie meistern sie die Krise?
Gemeinsam mit dem Bundesverband Deutsche Startups veröffentlicht das Borderstep Institut in der kommenden Woche den Green Startup Monitor, um diese und andere Fragen zu beantworten. Die Pressekonferenz wird als Videokonferenz stattfinden.
Um die Videokonferenz zu verfolgen, bitte auf diesen Link klicken.
Programm Pressekonferenz, 29. April 2020
Folgende Speaker stehen Rede und Antwort:
Prof. Dr. Klaus Fichter, Direktor des Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit gemeinnützige GmbH, Co-Autor Monitor
Dr. Yasmin Olteanu, Researcherin beim Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit gemeinnützige GmbH, Co-Autorin Monitor
Christian Miele, Präsident des Bundesverbandes Deutsche Startups
Torsten Kiedel, CFO Sono Motors
Die Videokonferenz wird moderiert von Paul Wolter, Teamleiter Politik und Kommunikation des Bundesverbandes Deutsche Startups.
CO2 Ausstoß in Wohnhäusern senken
CO2 Ausstoß in Wohnhäusern senken – wie kann das funktionieren? Mit dieser Frage beschäftigte sich Borderstep im Auftrag der Wirtschaftsinitiative Smart Living. Die Ergebnisse stellt jetzt die Fachzeitschrift „Die Wohnungswirtschaft“ in ihrer Aprilausgabe vor.
Energieffizienz in Wohnhäusern senkt Kosten für Mieter und Vermieter
Die gute Nachricht: Mit den in der Studie ermittelten Potenzialen können die Klimaschutzziele im Jahr 2030 erreicht werden. Gebäudeautomation ermöglicht die Senkung des Energieverbrauchs im Bestand und kann sinnvoll mit allen anderen Maßnahmen (Dämmung, erneuerbare Energien, Wärmepumpen, etc.) kombiniert werden. Energieeffizienz in Wohnhäusern senkt auch die Kosten, wovon Mieter und Vermieter in der aktuellen Situation (Mietenspiegel, Mietendeckel, Krisenfolgen) gleichermaßen profitieren.
Der Gebäudesektor macht rund 36 % des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland aus. Nicht umsonst widmet „Die Wohnungswirtschaft“ deshalb ihre komplette April-Ausgabe dem Thema Energiemanagement.
Wie kann Energiemanagement im Mehrfamilienhaus gelingen?
Borderstep Geschäftsführer Dr. Severin Beucker kommt in einem Interview zu Wort. Sie finden es auf Seite 24 in der Ausgabe 4/2020 der Zeitschrift „Die Wohnungswirtschaft“ (s. Kasten).
Borderstep Researcher Simon Hinterholzer stellt in einem Artikel die konkreten Zahlen vor, wie Energiemanagement im Mehrfamilienwohnhaus gelingen kann.
Borderstep bei ZDF heute
Corona sorgt für Hochbetrieb im Internet: Dr. Ralph Hintemann, Experte für das Thema Digitalisierung bei Borderstep, kommentiert die Folgen dieser Entwicklung in einem Beitrag der Nachrichtensendung ZDF heute.
Autor Stefan Schlösser beschäftigt sich darin mit der Frage, welche Auswirkungen die aktuelle Krise auf die CO2-Bilanz hat. Wie wirken sich Homeoffice und Streaming-Marathon auf das Klima aus?
Die Sendung vom 2. April 2020 kann hier angesehen werden (Beitrag „Hochbetrieb im Internet“ ab 06:42).
Projekt GO forciert die Wärmewende
Wie kann der Staat aktiv die Verbreitung von radikalen Umweltinnovationen unterstützen? Das Borderstep-Vorhaben GO hat zum Ziel, diese Frage am Beispiel der Wärmewende zu beantworten. In der Region Hannover wird durch verschiedene Interventionen versucht, die regionale Wärmewende richtungssicher in Schwung zu bringen.
Erster Schritt ist eine Erfassung der vorhandenen regenerativen Wärmepotenziale, im zweiten Schritt wird versucht, diese ins lokalpolitische Gespräch zu bringen. Borderstep wirkt hier nicht nur aktiv mit, sondern beobachtet und dokumentiert den Prozess um daraus für die Governanceforschung zu lernen. Neues dazu bald auf der Projekt-Website zu Go.