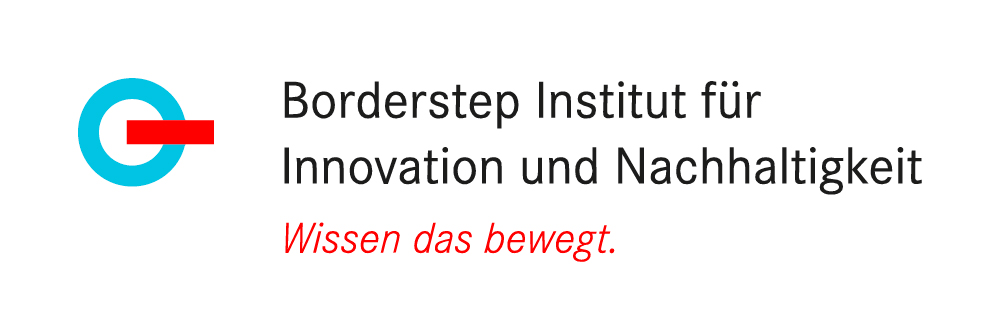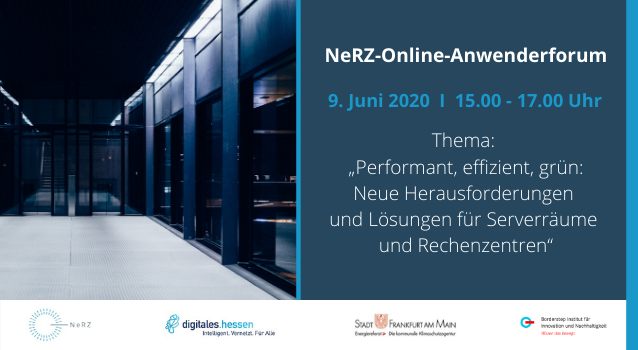Der Bericht kann kostenfrei über die Webseite des UBA heruntergeladen werden.
Wie können Stadtlandschaften satt machen?
Die Nutzung von Stadtlandschaften für die Nahrungsmittelproduktion macht Städte nachhaltiger und lebenswerter. Zugleich ist sie eine Chance für Start-ups, innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Bereits seit September 2018 knüpft deshalb das durch die EU geförderte Projekt EdiCitNet dafür ein globales Netzwerk von Städten. Es analysiert die Vorteile von sogenannten „Edible City Solutions“. Ziel ist die internationale Verbreitung solcher Lösungen – die Stadt soll „essbar“ werden.
Ackerbau in Stadtlandschaften
Das Borderstep Institut unterstützt in den kommenden drei Jahren das Projekt. Ziel dabei ist, Initiativen, Start-ups und Gründungsinteressierte beim Aufbau von tragfähigen, nachhaltigen Geschäftsmodellen zu begleiten. Wie können Wissenslücken bei der effektiven Umsetzung von Edible City Solutions geschlossen und kreative Erlösmodelle entwickelt werden? Das war Thema eines ersten Arbeitstreffen. Es fand beim Projektpartner Nabolagshager in Oslo statt.
Innovative Geschäftsmodelle für die essbare Stadt
Die Menschen in den Städten sollen mit dem Projekt in die Lage versetzt werden, den Reichtum und die Vielfalt der bestehenden Edible City Solutions bewusst wahrzunehmen. In einem zweiten Schritt können dann erfolgreich erprobte Edible City Solutions für den jeweilig spezifischen städtischen Kontext angepasst und umgesetzt werden. Das Projekt nimmt dabei die gesamte Kette der städtischen Lebensmittelproduktion in den Blick. Gesellschaftliche Herausforderungen wie Massenurbanisierung, soziale Ungleichheit, Klimawandel und Ressourcenschutz in Städten sind Teil der Untersuchung.
Das Vorhaben wird von der Humboldt Universität zu Berlin koordiniert.
Borderstep auf dem Future Mobility Summit 2020
Über die Dialogreihe:
Die Dialogreihe: Grüne Gründungen stärken! hat das Ziel, Kenntnisse über die Rahmenbedingungen, die Bedeutung, die Trends und die Hürden grüner Start-ups zu vermitteln.
Dadurch sollen neue oder verstärkte Initiativen zur zielgruppengerechten Förderung grüner Start-ups ausgelöst werden. In den Jahren 2019 und 2020 werden insgesamt 12 Dialogveranstaltungen, verteilt über das gesamte Bundesgebiet durchgeführt.
Partner für die gesamte Dialogreihe ist der Bundesverband Deutsche Startups e.V. (Startup-Verband).
Gefördert werden die Veranstaltungen von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU).
8. September 2020: Dialogveranstaltung im Rahmen des Tagesspiegel Future Mobility Summit
Session 1: Start-up Dialog | 10:35 – 11:20 Uhr
Finanzierung, Personal, Zukunftstechnologien: Wie gelingt Mobility Start-ups der Neustart in der Krise?
Die von der Corona Pandemie ausgelöste Krise stellt viele Mobility Start-ups vor große Herausforderungen. Für einige der Unternehmensgründungen bedeutet das Kurzarbeit und Umsatzrückgänge. In anderen Bereichen des Mobilitäts-Sektors stehen die Zeichen auf Wachstum. Die Politik erprobt Maßnahmen von Kaufanreizen bis zum Green New Deal. Mit Investoren, Start-ups und dem Ökosystem diskutieren wir über Lösungsansätze und Chancen in der Branche.
Der Start-up Dialog ist kuratiert vom Borderstep Institut in Kooperation mit DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt und Bundesverband Deutsche Startups e.V.
Die Session „Start-up Dialog“ des Future Mobility Summit 2020 ist Teil der Borderstep Dialogreihe „Grüne Gründungen stärken!“. Sie hat das Ziel, Kenntnisse über die Rahmenbedingungen, die Bedeutung, die Trends und die Hürden grüner Start-ups zu vermitteln. Dadurch sollen Initiativen zur zielgruppengerechten Förderung grüner Start-ups ausgelöst oder verstärkt werden.
Session 2: Future Mobility Pitch | 12:30 – 13:30 Uhr
Innovationen für die Mobilität der Zukunft
Welche Konzepte entwickeln grüne Start-ups für die Zukunft der Mobilität? Wir haben sechs erfolgversprechende Start-ups für unseren Future Mobility Pitch ausgewählt.
In dieser Session präsentieren sich die Gründerinnen und Gründer im Live-Pitch der Fach-Jury und stellen sich dem Feedback der Expertinnen und Experten.
Das letzte Wort hat das Publikum: Welches Start-up erkämpft sich den Future Mobility 2020 Pitch Audience Award?
Der Future Mobility Pitch ist Teil des Formats „Start-up Dialog“. Dieser ist kuratiert vom Borderstep Institut in Kooperation mit DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt und Bundesverband Deutsche Startups e.V.
Wie lassen sich Flexibilitäten für die Energiewende nutzen?
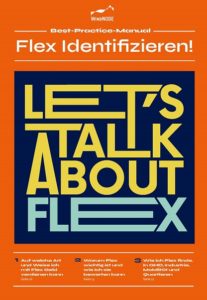 Das Aufspüren und Nutzen von Flexibilitätsoptionen in Unternehmen und Organisationen kann tatsächlich einfach sein. Davon sind zumindest die Partner des Projekts WindNODE überzeugt. Ihre Erfahrungen haben sie jetzt im „Best-Practice-Manual. Let’s Talk About Flex“ zusammengetragen, das explizit zum Nachmachen inspirieren will.
Das Aufspüren und Nutzen von Flexibilitätsoptionen in Unternehmen und Organisationen kann tatsächlich einfach sein. Davon sind zumindest die Partner des Projekts WindNODE überzeugt. Ihre Erfahrungen haben sie jetzt im „Best-Practice-Manual. Let’s Talk About Flex“ zusammengetragen, das explizit zum Nachmachen inspirieren will.
WindNODE veröffentlicht Best-Practice-Manual
Mit dem Best-Practice-Manual: Flex Identifizieren! leisten die Partner des Projekts WindNODE – Das Schaufenster für intelligente Energie aus dem Nordosten Deutschlands einen praxisorientierten Beitrag zur Diskussion über den Einsatz von Flexibilitäten für die Energiewende.
Das Manual legt den Fokus auf die individuellen Identifikations- und Nutzungsmöglichkeiten von Flexibilität und erlaubt einen Blick auf die Prozesse der Projektarbeit und die erfolgreiche Anwendung der vorgestellten Methoden.
Diese konkreten Fallstudien zu Flexibilitäten werden vorgestellt:
- Die Schwarz Gruppe (Lidl und Kaufland) hat die Entlastung des Stromnetzes in Zeiten von Erzeugungsspitzen erneuerbarer Energien durch die Einspeicherung in einen Batteriespeicher an der Lidl-Schaufensterfiliale erprobt.
- Wie identifizierte Flexibilitätsoptionen in der Industrie für verschiedene Optimierungsziele genutzt werden können, zeigt Siemens durch die Erfassung und Kategorisierung von industriellen Prozessen in Verbindung mit modernen Messgeräten und einem Energiemanagement-System.
- Das „ZIEL“-System (Zukunftsfähiges Intelligentes Energie- und Lastmanagement) des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU, das in Kooperation mit Deckel Maho Seebach entstanden ist, verschiebt energieintensive Fertigungsaufträge in Abhängigkeit von Energiepreisen und regelt aktiv die dezentrale Energieinfrastruktur in Fabriken.
- In der Elektromobilität nutzt die BSR die Energiemanagement-Software EnEffCo® von ÖKOTEC, um Potenzialanalysen für die Flexibilitätsoptimierung durchzuführen und in den (prototypischen) Regelbetrieb zu überführen.
- In einem Berliner Quartier, das mit Smart-Building-Technik ausgerüstet ist, erprobt das Borderstep Institut die markt- und netzdienliche Steuerung eines BHKW sowie von Power-to-Heat-Elementen.
Ratgeber für den Weg zum intelligenten Energiesystem
Mit dem Best-Practice-Manual ist damit ein wichtiger Ratgeber für den Weg zum intelligenten Energiesystem entstanden, der dabei hilft, die Integration und Nutzung von erneuerbarem Strom vom Wohnquartier bis zur Fabrik zu optimieren und auf die Verfügbarkeit lokaler regenerativer Energie abzustimmen.
Streamingdienste haben eine schlechte Öko-Bilanz
In Zeiten von Homeoffice und Homeschooling werden Streamingdienste aller Art viel genutzt. Das hat Auswirkungen auf die Klimabilanz.
In einem Beitrag von rbb inforadio erläutert Dr. Ralph Hintemann, Experte für das Thema Digitalisierung bei Borderstep, den Zusammenhang von Videostreaming und CO2-Ausstoß.
Der Beitrag kann über die Webseite von rbb inforadio nachgehört werden.
Hier finden Sie ein Hintergrundpapier mit den Ergebnissen einer Borderstep-Kurzstudie zum Thema Videostreaming zum kostenfreien Download.
Grüne Start-ups brauchen mehr Rückenwind
Rückenwind und Kapital gesucht: Ein Artikel auf der Innovationsplattform der Bertelsmannstiftung stellt die Ergebnisse des Green Startup Monitors 2020 vor. Mit diesem Instrument analysiert Borderstep in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Deutsche Startups die grüne Start-up Szene Deutschlands.
Das Autorenteam untersucht, wie sich das Ökosystem der nachhaltigen Gründungen in den letzten Jahren entwickelt hat und welche Formate positiv auf die Community wirken. Ein Beispiel dafür ist der StartGreen Award, den Borderstep seit 2015 im Rahmen der Gründerwoche vergibt.
Dass Nachhaltigkeit kein explizit „grünes“ Thema ist, zeigt das Projekt Sustainability4All, das der Beitrag ebenfalls vorstellt. Sein Ziel ist, Nachhaltigkeit im gesamten Gründungsgeschehen zu verankern – für zukunftssicheres Wirtschaften und stabile Geschäftsmodelle. Wie die aktuelle Krise demonstriert, sind alle Unternehmen gut beraten, sich damit zu befassen. Und zwar nicht nur, um „der Umwelt“ zu dienen, sondern zunächst einmal sich selbst.
Investoren erkennen inzwischen den Wert von nachhaltigen Geschäftsmodellen und steuern ihre Investionen entsprechend. Dennoch bleibt die Kapitalfrage das größte Problem von grünen Gründungen, konstatieren die Autoren.
Hier kann man den vollständigen Artikel nachlesen.
Videostreaming: Energiebedarf und CO2-Emissionen
Videostreaming liegt im Trend. In Deutschland nutzen mehr als 24 Millionen Menschen bereits kostenpflichtige Streaming Angebote und verbringen in Summe weit mehr als eine Milliarde Stunden auf diesen Diensten – pro Quartal.
Starke Zunahme von Streaming-Angeboten lässt Datenmenge explodieren
Eine Folge der starken Zunahme von Streaming-Angeboten ist die stark ansteigende Menge an Daten, die im Internet übertragen werden. Im Jahr 2019 wurden in Deutschland etwa 57 Mrd. Gigabyte über das Festnetz transportiert, dies entspricht einer Verdopplung gegenüber 2016. Video-Daten machen aktuell etwa 75 Prozent des Internet-Datenverkehrs aus und es wird von einem weiter stark ansteigenden Video-Datenverkehr im Internet ausgegangen.
Diese Entwicklungen werfen die Frage auf, welche Auswirkungen Videostreaming auf den Energiebedarf und die CO2-Emissionen hat. In Zeitschriftenartikeln und Fachbeiträgen werden aufgrund unterschiedlicher Berechnungs-methoden und Annahmen hierzu teilweise sehr unterschiedliche Angaben gemacht.
Borderstep hat deshalb ein Hintergrundpapier zum Thema erarbeitet. Es soll dazu beitragen, den aktuellen Energiebedarf und die CO2-Emissionen des Video-Streamings zu bewerten. Energiebedarf und CO2-Emissionen werden mit einem transparenten Berechnungsverfahren für verschiedene Anwendungsszenarien des Videostreamings berechnet und gegenübergestellt.
Videostreaming und Energieverbrauch: Das Wichtigste in Kürze
- Eine Stunde Video-Streaming in Full-HD-Auflösung benötigt 220 bis 370 Wattstunden elektrische Energie, abhängig vom verwendeten Endgerät. Das verursacht etwa 100 bis 175 Gramm Kohlendioxid (CO2), also ähnlich wie die Emis-sionen eines Kleinwagens bei einem Kilometer Autofahrt.
- Der Energiebedarf des Video-Streamings hängt stark davon ab, mit welcher Auflösung gestreamt wird. Wird statt mit HD-Auflösung mit einer Auflösung von 4K gestreamt, können pro Stunde fast 1.300 Wattstunden an elektrischer Energie benötigt werden, was in etwa einer Emission von 610 Gramm CO2 entspricht.
- Effizienzverbesserungen können künftig zu einer Absenkung des Energiebedarfs des Videostreamings führen. Der Trend zu größeren Bildschirmen und höheren Auflösungen kann diese Entwicklung aber auch kompensieren.
- Wer den Energiebedarf und die CO2-Emissionen beim Streamen senken will, kann dies durch die Wahl der Auflösung und des Endgeräts stark beeinflussen. Videostreaming muss nicht mehr Energie benötigen als klassisches Fernsehen oder als die Nutzung von DVDs oder Blu-ray-Disks.
- Die Klimawirkung von Videostreaming kann deutlich reduziert werden, wenn es gelingt, die vorhandenen Eff izienzpotenziale bei den Streaming-Diensten sowie in den Rechenzentren und Netzen auszuschöpfen und die digitalen Infrastrukturen mit regenerativ erzeugtem Strom zu betreiben.
Wie kann der Ökolandbau besser gefördert werden?
Herausforderung Ökolandbau: Sein Flächenanteil an der Landwirtschaft in Deutschland lag 2018 bei 9,1%. Explizites Ziel der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ist, diesen Anteil bis 2030 auf 20% steigern.
Nicht nur Verbesserungsinnovationen, sondern „groundbraking ideas“ gefragt
Die Methoden des Ökolandbaus sind derzeit nicht ausreichend erforscht. Das Forschungsbudget dafür erreicht optimistisch geschätzt bestenfalls fünf Prozent der öffentlichen wie privaten Agrarforschung. Der Ökolandbau braucht jedoch nicht nur kleinteilige Verbesserungsinnovationen, sondern „groundbreaking ideas“. Dafür besteht ein Bedarf an längerfristigen, also den üblichen Förderrahmen von 3 Jahren durchbrechenden Projekten. Dies ist das Fazit einer Borderstep-Studie im Auftrag des Umweltbundesamts (UBA). Autor ist Borderstep-Mitgründer Dr. Jens Clausen, der im Institut den Bereich Nachhaltigkeitsinnovationen betreut.
Wie finden Innovationen und Ökolandbau zusammen?
In seinem Bericht identifiziert Jens Clausen die Akteure des Innovationssystems, Instrumente sowie Stärken und Schwächen der Innovationsförderung für den Ökolandbau und zieht Konsequenzen für eine Umweltinnovationspolitik. Für die Entstehung grundsätzlich neuer Ideen haben aber nicht nur Forschungsinstitutionen und –projekte eine hohe Bedeutung, sondern auch Start-Ups. Mit dem Begriff AgTech werden seit einigen Jahren solche Technologiegründungen rund um die Landwirtschaft beschrieben und in ersten Akzeleratoren werden diese StartUps gefördert.
Wie kann der Staat Umweltinnovationen beim Durchbruch helfen?
Oft sind Umweltinnovationen bei ihrer Markteinführung vergleichsweise teuer und nicht optimal an die Bedürfnisse der späteren KundInnen angepasst. Der Staat kann in diesen Fällen durch Forschungs- und Förderprogramme Entwicklungen anstoßen, die Angebote preiswerter oder anschlussfähiger machen. Das untersucht Borderstep im Projekt „Klimaschutzpotenziale der Digitalen Transformation“ (CliDiTrans).
Vernetzung gesellschaftlicher Akteure
So kann der Staat z.B. durch die Einrichtung entsprechender Plattformen die Vernetzung gesellschaftlicher Akteure fördern. Das bündelt die Interessen einzelner institutioneller Akteure und verleiht ihnen mehr Durchsetzungskraft. Ein Beispiel hierfür sind die staatlich unterstützten „Beschaffungsgruppen“ in Schweden, in denen sich private Wohnungsgesellschaften vernetzen. Die Bündelung der Nachfrage treibt die Entwicklung und Diffusion von energieeffizienten Technologien im Gebäudebereich voran.
Ein weiteres positives Beispiel ist das Programm Energiesprong aus den Niederlanden. Das darin geschaffene Netzwerk aus Wissenschaftsinstitutionen, Marktteilnehmern und der Regierung entwickelt neue, kosteneffiziente Sanierungskonzepte und bringt sie auf den Markt.
Publikation erschienen
Die Publikation zum Thema steht kostenfrei zum Download bereit.
Deutscher Startup Monitor: Jetzt mitmachen
Wie geht es dem deutschen Startup-Ökosystem? Wie kann in der aktuellen Corona-Krise die Innovationsfähigkeit des Landes gestärkt werden? Das ermittelt derzeit der Bundesverband Deutsche Startups e.V. in seiner Umfrage zum achten Startup Monitor.
Welche Rolle spielt das Startup-Ökosystem in Deutschland?
Gründerinnen und Gründer des Landes sind dazu eingeladen, auf die Bedürfnisse ihrer Start-ups und ihres Gründungsstandortes aufmerksam zu machen. Mit der Befragung soll die wichtige Rolle des Startup-Ökosystems in Deutschland herausgestellt werden.
Mit der ersten Säule des Startup-Rettungspakets wurden in den letzten Wochen bereits wichtige Schritte geleistet, um das Startup-Ökosystem zu unterstützen. Jetzt sind die einzelnen Stimmen der Start-ups weiterhin gefragt, um wichtige Impulse für eine zukunftsfähige Volkswirtschaft zu entwickeln.
Rechenzentren als Treiber der Energiewende
Die Rechenzentren entwickeln sich zum Treiber der Energiewende. Der zunehmende Energiehunger der Internetbranche und die steigende Nutzung von Cloud Services stellen sie dabei vor neue Herausforderungen. Welche Ansätze ebnen den Weg zum leistungsfähigen, kosteneffizienten und zugleich nachhaltigen Rechenzentrum?
Das diskutiert am 9. Juni 2020 von 15 bis 17 Uhr im Online-Anwendungsforum „Performant, effizient, grün: Neue Herausforderungen und Lösungen für Serverräume und Rechenzentren“ das Netzwerk energieeffiziente Rechenzentren (NeRZ) mit Hessens Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus und Betreibenden von Rechenzentren. Im Fokus der Diskussion stehen aktuelle Entwicklungen des Rechenzentrumsmarktes sowie neue regulative Herausforderungen für kleine und mittelständische Rechenzentrumsbetreiber.
Das von Borderstep koordinierte Netzwerk NeRZ veranstaltet das Anwenderforum in Kooperation mit der Geschäftsstelle Digitales Hessen und dem Energiereferat der Stadt Frankfurt am Main. Die Zahl der Plätze ist begrenzt, die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei nach Anmeldung.
Online-Registrierung: Mehr
Agenda: Mehr