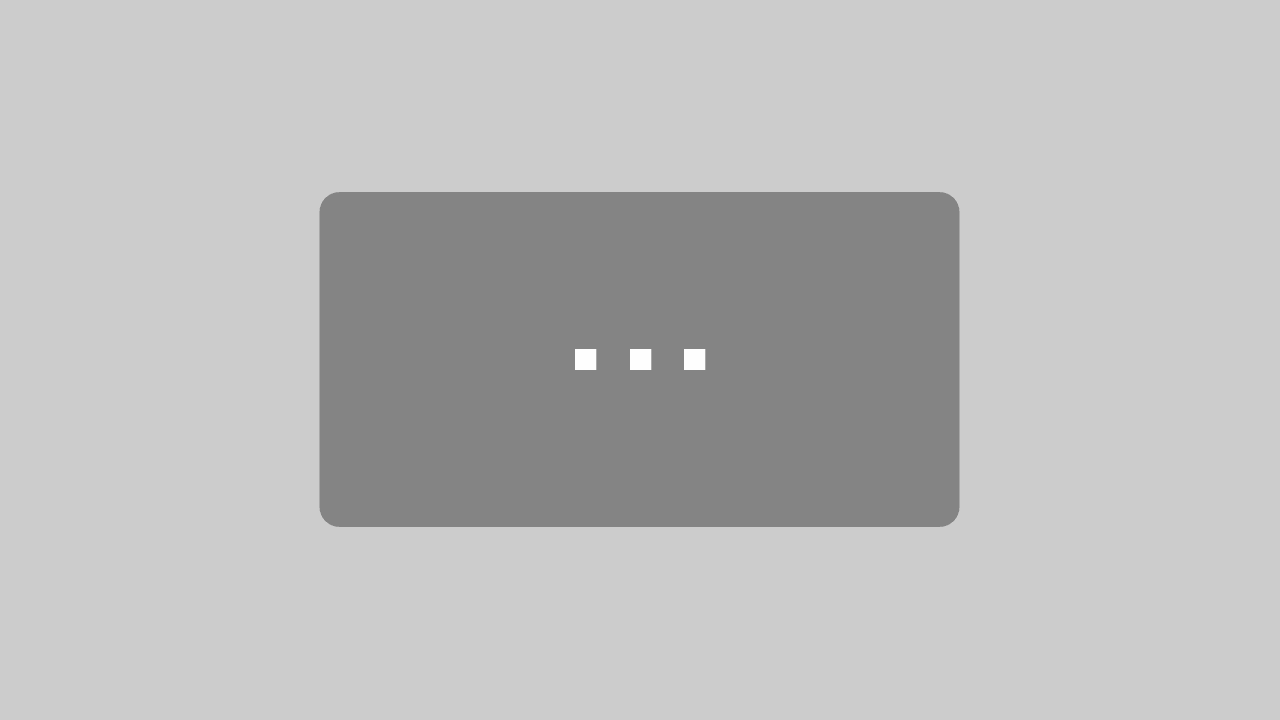Borderstep bei Smart Living Summit 2024
Im Fokus des Smart Living Summit 2024 stehen Innovationen im Gebäude-Energiemanagement. Dr. Severin Beucker, Senior Researcher des Borderstep Instituts, gestaltet die Fachsession „Digitale Infrastruktur“.
Der Markt für intelligentes Wohnen im digitalen Zuhause boomt. Der Smart Living Summit 2024 präsentiert branchenübergreifend Wissen rund um innovative Smart-Living-Technologien und mögliche neue Geschäftsmodelle.
Borderstep gestaltet Fachsession „Digitale Infrastruktur“
Dr. Severin Beucker gestaltet gemeinsam mit Prof. Dr. Thomas Heimer von der Hochschule RheinMain / Technopolis Group die Fachsession „Digitale Infrastruktur“.
Bayern Innovativ und SmartHome Initiative Deutschland bündeln dafür bei diesem Top-Event ihre Kompetenzen mit der Wirtschaftsinitiative Smart Living, dem KEDi – Kompetenzzentrum für Energieeffizienz durch Digitalisierung und dem GdW – Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen.
Im Fokus stehen Innovationen im Gebäude-Energiemanagement, welche auch für eine Umsetzung des „Erneuerbare Energien Gesetz“ wichtig sind. Weitere thematische Schwerpunkte umfassen u.a. Smart Living in der Wohnungswirtschaft, Digitale Infrastruktur, Smart Health und Cyber Security.
Smart Living Summit 2024: Netzwerken im Fokus
Interaktive Podiumsdiskussionen, eine begleitende Fachausstellung, B2B-Matchmaking oder das Abendevent bieten vielfältige Möglichkeiten zum Netzwerken und zum inhaltlichen Austausch.
Das Programm, Details zur Anmeldung sowie weitere Informationen finden Sie online auf der Veranstaltungswebsite.
Gebäudeforum klimaneutral: Borderstep neuer Netzwerkpartner
Klimaneutral bauen, sanieren, heizen – wie funktioniert das in der Praxis? Darüber informiert das Gebäudeforum klimaneutral auf seiner Plattform. Das Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit ist nun offizieller Netzwerkpartner der Initiative. Auf dem Online-Portal wird das Borderstep Institut und seine Rolle im Netzwerk ausführlich vorgestellt. Durch die Partnerschaft will das Institut aktiv zur Förderung und Umsetzung klimaneutraler Gebäudekonzepte beitragen.
Heizungsoptimierung durch Digitalisierung
Heizungsoptimierung durch Digitalisierung: Zu diesem Thema hat Gebäudeforum klimaneutral wichtige Informationen auf einer eigenen Seite zusammengestellt. Wie viel kann durch Digitalisierung des Heizens wirklich eingespart werden? Was kann die Wohnungswirtschaft leisten und welche Chancen bietet das für Umwelt und Gesellschaft? Welche Herausforderung stellt der Fachkräftemangel dar? Diese und andere Themen beleuchtet das Online-Portal im Schwerpunkt Heizen.
Portal stellt auch Leitfaden zur Gebäudeautomation vor
Die Webseite stellt auch der Leitfaden zur Gebäudeautomation vor, den Borderstep im Forschungsprojekt DiKoMo entwickelt hat. Das Vorhaben hat untersucht, wie die Verbreitung und der Einsatz digitaler Gebäudetechnik – insbesondere Gebäudeautomation – verbessert werden kann. Die in diesem Rahmen entwickelte Handreichung stellt neutral und herstellerunabhängig Informationen zum Thema Gebäudeautomation zur Verfügung:
- Was verbirgt sich hinter der Technik?
- Wie funktioniert sie?
- Wieviel Energie lässt sich damit einsparen?
- Was kostet die Technik bzw. wie kann sie finanziert werden?
Klimaneutrales Bauen und Sanieren
„Gebäudeforum klimaneutral“ ist ein Angebot der dena im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Das Best Practice Portal stellt erfolgreiche Lösungsansätze im Bereich klimaneutrales Bauen und Sanieren vor. Ziel ist es, die Energiewende zu unterstützen und Ansprechpersonen für konkrete Fragen rund um Klimaschutz im Gebäudebereich eine Plattform zu geben.
Von Einhörnern und Zebras: Borderstep in Schloss Bellevue
„Von Einhörnern und Zebras: Wie grüne Start-ups eine nachhaltige Wirtschaft gestalten“: Das ist der Titel einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Woche der Umwelt im Garten von Schloss Bellevue. Prof. Dr. Klaus Fichter, Gründer und Leiter des Borderstep Instituts, stellt aktuelle Forschungsergebnisse aus dem Bereich Sustainable Entrepreneurship zur Debatte. Zu der Veranstaltung laden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) ein. Die DBU ist ein langjähriger Partner des Borderstep Instituts.
Auf die Gäste der Woche der Umwelt wartet ein attraktives Fachprogramm. Rund 190 Ausstellende präsentieren im Park von Schloss Bellevue ihre innovativen Lösungen für eine verantwortungsvolle Gestaltung des Wandels.
Dort präsentiert sich auch die Green Start-up-Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Sie unterstützt Start-ups, die umweltentlastende, innovative und wirtschaftlich tragfähige Geschäftsmodelle entwickeln. Sie erhalten von der DBU finanzielle und ideelle Förderung. Die Angebote der Green Start-up Förderung bei der Woche der Umwelt bieten umfassenden Einblick in das Ökosystem grüner Start-ups und beleuchten die verschiedenen Perspektiven relevanter Akteure.
Prof. Fichter ist Mitglied der Jury für das DBU-Green-Start-up-Programm. Die Auswahlsitzung der Jury tagt am selben Tag im Schloss Bellevue.
Auf der Fachbühne im Schlossgarten erhalten ausgewählte DBU-geförderter Green Start-Ups die Gelegenheit, ihre Ideen vor einem breiten Publikum zu präsentieren.
Mit dabei sind:
- Prof. Dr. Klaus Fichter, Professor für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg sowie Direktor des Borderstep Instituts für Innovation und Nachhaltigkeit, Berlin
- Lea Schücking, Gründerin des DBU-geförderten Start-ups Shards GmbH
- Sing-Hong Stefan Chang, Gründer und Geschäftsführer des DBU-geförderten Start-ups Infinity StartUp GmbH
- Felix Gruber, Leiter der DBU-Ateilung Umwelttechnik
- Fabian Vorländer, DBU-Green-Start-up-Programm
- und als Überraschungsgäste: Start-ups aus dem tagesaktuellen DBU-Green Start-up-Pitch
Hier finden sich alle Informationen zum gesamten Programm der Woche der Umwelt der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.
Borderstep beim EXIST-Kongress 2024
EXIST-Kongress 2024: Prof. Dr. Klaus Fichter, Gründer und Leiter des Borderstep Instiuts, ist Teil der Jubiläumsausgabe des EXIST-Kongresses, der am 6. und 7. Juni 2024 in Berlin stattfindet. EXIST (Existenzgründungen aus der Wissenschaft) ist ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, das Ausgründungen aus der Wissenschaft unterstützt.
Prof. Fichters Keynote „Transformation durch SDGs und Wirkungsmessung oder wie alles begann? Und welchen Beitrag GründerInnen dazu leisten können?“ bildet den Auftakt der Session 7: Impact Startups. Impact-Startups sind Treiber für notwendige positive Veränderungen in Gesellschaft und Umwelt. Die Teilnehmenden der Session erfahren mehr über innovative Geschäftsmodelle, Technologien und Initiativen, die einen nachhaltigen wirtschaftlichen und sozialen Wandel fördern.
Zwei Expert-Talks entwickeln dabei Vorschläge für bessere Gründungs- und Wachstumsbedingen von Impact Startups.
- Expert Talk 1: Wir gestalten Impact! Aus Sicht von Start-ups/Hochschulen
- Expert Talk 2: Wie prognostiziert man den Impact von Gründungsideen und welche Rolle spielt die Gründungsberatung?
Das vollständige Programm zum EXIST-Kongress 2024 ist hier nachzulesen.
Berliner Energietage 2024: Videos jetzt online
Wieso ist es für den Erfolg der Wärmewende so wichtig, neue Kommunikationsstrategien zu entwickeln? Darüber sprach Borderstep Mitgründer Dr. Severin Beucker im Rahmen der Berliner Energietage 2024 mit dem YouTube Kanal „Energieforschung“. Auf diesem berichtet der Projektträger Jülich (PtJ) im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) über die Forschungsförderung des Ministeriums im Energieforschungsprogramm und stellt die Menschen hinter der Energiewende vor.
Was hat Kommunikation mit Investitionsentscheidungen in der Energiewende zu tun? Severin Beucker sprach im Rahmen der Berliner Energietage 2024 über Ergebnisse des Projekts DiKoMo, das unter anderem diese Frage untersucht hat. Hier kann man das Video ansehen.
Ein weiteres Video gibt einen Einblick über die Energietage als Austauschplattform rund um die Energiewende. Auch Severin Beucker kommt zu Wort.
Wärmeversorgung: Strom schlägt Erdgas und Wasserstoff
Prof. Dr. Claudia Kemfert (DIW) und Borderstep Mitgründer Dr. Jens Clausen rechnen für den Tagesspiegel Background nach, welche Form des Heizens bei der Betrachtung aller Kosten die Nase vorn hat. Ihr Fazit: Bei der klimagerechten Wärmeversorgung schlägt die Wärmepumpe sowohl Erdgas als auch Wasserstoff.
Ihren Standpunkt kann man beim Tagesspiegel hier nachlesen.
Vergleich: Wärmeversorgung mit Wasserstoff, Gas oder Wärmepumpe
Die vollständige Kurzstudie kann unter Borderstep Publikationen kostenfrei abgerufen werden.
Worum geht es? Einige Deutsche Gasversorger rechnen damit, dass auch nach der Wärmewende ein großer Bedarf an klimaneutralem Gas zum Heizen gedeckt werden muss. Alternativ müssten auch diese Gebäude mit Wärmepumpe beheizt werden. Aber wie schnell ist das realisierbar? Woher soll die Energie dazu kommen? Wieviel Geld kostet es? In einer Studie haben Fachleute des Borderstep Instituts sowie aus den Reihen der Scientists for Future die Heizung mit Wasserstoff im Vergleich zum Heizen mit der Wärmepumpe durchgerechnet.
E-Fuels: Was würde eine Umstellung darauf wirklich kosten?
Auf Deutschlands Straßen fahren 50 Millionen PKW, auf denen von Niedersachsen 5 Millionen. In Zukunft können sie elektrisch fahren. Oder mit E-Fuels, also künstlichem Benzin. Aber wie schnell ist das realisierbar? Wieviel Geld kostet es? In einer neuen Studie haben Dr. Jens Clausen und Dr. Severin Beucker, beide Senior Researcher des Borderstep Instituts, gemeinsam mit einem Team der Scientists for Future (S4F) einen PKW-Verkehr mit E-Fuels durchgerechnet.
Das Fahren mit E-Fuels ist ineffizient. Das macht es zur Kostenfalle. Während ein Elektromotor 85 % der Antriebsenergie in Bewegung umsetzt, sind es bei einem Verbrenner nur 25 % bis 30 %. Auf dem Weg vom grünen Strom zum E-Fuel gehen weitere 56 % der Energie verloren. Der Strombedarf für die Herstellung der E-Fuels für die 5 Millionen Autos in Niedersachsen beträgt etwa 115 TWh Strom. Eine Elektroautoflotte würde schon mit knapp 15 TWh Strom im Jahr rollen.
S4F-Mitglied und Borderstep Forscher Dr. Jens Clausen, Erstautor der Studie, stellt fest: „Für die enormen Strommengen für die E-Fuels müssten wir in Niedersachsen 6.000 große Windräder bauen und 480 km2 PV-Anlagen errichten. Die Investitionen in Windkraft, PV und Elektrolyse addieren sich zu 100 Milliarden Euro. Die Investitionen in die Stromerzeugung für die Elektromobilität sind schon für 10 % davon zu haben.“
Warum nicht billig importieren?
Die Herstellung von E-Fuels ist nicht nur hierzulande aufwendig, sondern auch in möglichen Lieferländern. Sucht man dort Standorte mit mehr Wind oder mehr Sonne aus, sinken die Kosten für die Stromerzeugung etwas. Dafür kommen Hafenanlagen, Tanker und Transportkosten hinzu. Künstliche Kraftstoffe sind also auch als Importware teuer und würde die Außenhandelsbilanz stark belasten.
Kostenfalle für die Autofahrerinnen und Autofahrer
Der jährliche Strombedarf für ein Elektroauto beträgt etwa 2.700 kWh. Das belastet den Geldbeutel im Jahr mit etwa 1.000 Euro. Um die durchschnittlichen 13.700 km, die ein PKW in Deutschland so fährt, mit E-Fuels fahren zu können, würden pro Auto um die 3.000 Euro an der Tankstelle anfallen. Die Mehrkosten für ein Elektroauto, die heute noch 5.000 Euro betragen, würden sich so in zweieinhalb Jahren amortisieren. In absehbarer Zeit werden Elektroautos jedoch vermutlich billiger zu kaufen sein als Verbrenner.
Schädlich für die Menschen in Städten und Dörfern
Bei Elektroautos gibt es keine schädlichen Abgase aus der Verbrennung. Wenn wir mit E-Fuels fahren, würde das die Schadstoffbelastung unserer Städte und Dörfer nicht reduzieren. Die derzeit vielen frühen Todesfälle, tausende Asthmaanfälle und tausende von verlorenen Arbeitstagen würden weiterhin die Kosten des Gesundheitssystems unnötig in die Höhe treiben.
E-Fuels: Teuer und gesundheitsschädlich
E-Fuels scheinen für die Politik derzeit ein Mittel, das Fahren von Verbrennern weiter zu erlauben und Klimaneutralität an der Tankstelle einzukaufen. Allerdings ist bei Lichte betrachtet ihre Herstellung teuer – und die Schadstoffbelastung hoch. Aufgrund des umfänglichen Ausbaus von grüner Stromerzeugung und E-Fuel-Herstellung wird es auch nicht schneller gehen als der Umstieg auf Elektrofahrzeuge. Als Alternative zur Elektromobilität können sich E-Fuels im Kampf um klimaneutrale Mobilität wohl nicht behaupten. Zudem wächst international der Markt für strombetriebenen Fahrzeuge weiter: im ersten Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahr um 25 %. Ob ein deutscher Sonderweg der heimischen Industrie helfen würde, darf also mit Recht bezweifelt werden.
Borderstep beim Data Center Expert Summit
Data Center Expert Summit 2024: Wie verbessern Energiespeicher und Künstliche Intelligenz die Energieeffizienz im Rechenzentrum? Darüber spricht im Rahmen der Veranstaltung am 4. Juni 2024 Borderstep IT-Experte Dr. Ralph Hintemann. Er präsentiert unter anderem Ergebnisse aus dem Projekt DC2Heat.
Künstliche Intelligenz im Rechenzentrum: Borderstep im Interview
In diesem Interview stellt eco Dr. Ralph Hintemann und seine Postionen vor.
Hintemann betont im Interview die Herausforderung der smarten Wärmeverteilung: „Nachhaltige Wärmequellen – beispielsweise industrielle Abwärme – sind nicht immer dort, wo auch die Wärme gebraucht wird. Und auch zeitlich passt das Profil der Wärmequelle leider nicht immer zum Wärmebedarf. Genau deshalb brauchen wir ’smarte‘ Lösungen in der Wärmeversorgung.“ Wie kann Künstliche Intelligenz die Effizienz der Kühlung und des IT-Betriebs in Rechenzentren optimieren? Das untersucht Borderstep aktuell in einem Forschungsvorhaben. „Im Projekt DC2HEAT zeigen wir, wie man mit Hilfe von KI die Nutzung von Abwärme aus Rechenzentren einfacher und effizienter machen kann. KI hilft hier, Angebot und Nachfrage von Wärme besser aufeinander
abzustimmen und Wärmenetze effizienter zu betreiben.“
Fachkonferenz für die Rechenzentrumsbranche
Eco lädt bereits zum vierten Data Center Expert Summit ein. Die diesjährige Fachkonferenz für Entscheider, Betreiber, Planer und Anwender aus den Bereichen Rechenzentrums- und Serverraum-Betrieb findet in Offenbach am Main in der Alten Schlosserei statt. Die diesjährigen Hauptthemen umfassen: Greenfield & Brownfield, Resiliente Infrastrukturen, ESG & CSR-Reporting und Energiespeicherung.
Das Programm der Veranstaltung kann hier abgerufen werden. Tickets gibt es hier.
Tagesspiegel-Bericht: Wie sicher ist Wasserstoff?
Wasserstoff und seine Risiken: In einem Bericht im Tagesspiegel stellt der Autor Jan Kixmüller Perspektiven zum Thema vor. Ausgangspunkt ist eine Studie, die einen Zusammenhang von Beimischung von Wasserstoff und Undichtigkeit im Gasnetz nahelegt. Senior Researcher und Borderstep Mitgründer Dr. Jens Clausen kommt als Experte zu Wort. Er stellt aktuelle Forschungsergebnisse aus dem Borderstep-Portfolio zum Thema vor.
Studie: Beimischung von Wasserstoff kann zu Lecks im Gasnetz führen
Eine neue Studie im Auftrag der gemeinnützigen Environmental Coalition on Standards (ECOS) zeigt, dass die Beimischung von Wasserstoff zum herkömmlichen Erdgas zu einer deutlichen Zunahme von Undichtigkeiten im Gasnetz führen kann. Labortests bestätigen, dass Lecks an Gasgeräten wie Herden und Kochfeldern sowie an Gasboilern signifikant häufiger auftreten, wenn beigemischt wird. Die Untersuchung, durchgeführt von Enertek International in Großbritannien, erschien jetzt als nicht begutachteter „Preprint“ und stellt die erste quantitative Analyse der Auswirkungen von Wasserstoffbeimischungen auf Haushalte dar. Darüber hinaus widerlegt die Studie die Behauptung, dass die Beimischung von grünem Wasserstoff die Umweltsituation verbessern kann. Selbst eine geringe Rate von Leckagen macht den potenziellen Klimavorteil zunichte. Marco Grippa von ECOS betont, dass Wasserstoff keine geeignete Lösung für den Haushaltsgebrauch ist und empfiehlt stattdessen die Nutzung von elektrischen Wärmepumpen und Induktionsherden als sauberere, gesündere und sicherere Alternative zu Gas.
Die Netzbetreiber, besonders die Gasnetzbetreiber, sehen das anders. Laut einer Stellungnahme des Branchenverbands Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) bestehen über 97 Prozent der Rohrleitungen in deutschen Gasverteilnetzen aus wasserstofftauglichen Materialien wie Stahl und Kunststoff. Auch die Armaturen und Einbauteile stellen nach Ansicht des DVGW technisch keine grundlegenden Hindernisse für die Umstellung auf Wasserstoff dar.
Borderstep-Expertise aus verschiedenen Wasserstoff-Projekten
Dr. Jens Clausen, neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit am Borderstep Institut auch ein aktives Mitglied im Netzwerk Scientists for Future, war nicht an der ECOS-Studie beteiligt. Doch auch er betrachtet die Beimischung von Wasserstoff in Gasnetzen skeptisch. Clausen erklärt in dem Tagesspiegel-Beitrag, dass Leckagen nicht überraschend seien, da Wasserstoff das kleinste Molekül
ist. Seiner Meinung nach ist die ECOS-Studie solide und zuverlässig, da sie Untersuchungen aus verschiedenen Laboren enthalte und von Arbeiten unterstützt wird, die ihre Ergebnisse bestätigen.
Neu an den Ergebnissen sei laut Clausen, dass undichte Stellen in den Verteilnetzen und auch zu Hause beim Kunden als Quelle für Klimabelastungen benannt werden. Das betont auch ein Positionspapier von Scientists for Future, dass Wasserstoff als Ersatz für heutige fossile Anwendungen als teuer und ineffizient klassifiziert. Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch das Borderstep-Projekt „Wasserstoff als Allheilmittel„, das sich auch mit den Aufgaben der Politik diesbezüglich befasst hat..
Den ganzen Artikel finden Sie hier.
Policy Paper: Gebäudeautomation und Energiemanagement
Wie gelingt digitales Energiemanagement? Von digitalen Thermostaten bis zum automatisch gesteuerten Heizkessel: Mit Gebäudeautomation lässt sich vergleichsweise einfach Energie einsparen und die Klimabilanz eines Gebäudes verbessern. Trotzdem findet dieser Ansatz bisher wenig Verwendung.
Mehr Klimaschutz mit innovativem Energiemanagement
Vier Maßnahmen, mit denen die Politik zielgerichtet Investitionsanreize setzen kann, zeigt das Autorenteam in einem Empfehlungspapier. Es entstand im Rahmen des Projekts DiKoMo.
Das Projekt DiKoMo (Entwicklung von Diffusions-und Kommunikationsstrategien für intelligente Gebäudetechnik) wurde von den Forschungspartnern Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit, dem BIS Berliner Institut für Sozialforschung, dem IKEM Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V. sowie Kieback&Peter GmbH bearbeitet. Assoziierte Partner waren der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) e.V. sowie das Deutsche Energieberater-Netzwerk (DEN) e.V. Gefördert wurde das Vorhaben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK).